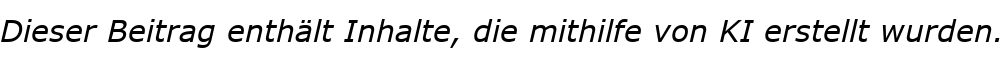Der Ausdruck ‚Kanake‘ hat seine Ursprünge im 19. Jahrhundert und wird oft negativ konnotiert. In Gebieten wie Südosteuropa, dem Nahen Osten, dem Mittleren Osten und Nordafrika fand dieser Begriff den Weg in den Sprachgebrauch der Seeleute, die von Reisen in den Southwest-Pazifik zurückkehrten. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf die indigenen Völker von Neukaledonien und Ozeanien, insbesondere die Polynesier. Trotz seiner negativen Konnotationen hat sich eine Form der Selbstidentifikation entwickelt, besonders durch politische Bewegungen wie ‚Kanak Attak‘, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. In diesem Zusammenhang wird ‚Kanake‘ von manchen als Ehrentitel betrachtet, der die Zugehörigkeit und Identität der Menschen betont. Die Verwendung des Begriffs in der Kanak-Sprak, einer Pidgin-Sprache, verdeutlicht zudem den Wandel in der Wahrnehmung dieser Bezeichnung im Laufe der Zeit. Auch der Begriff ‚Kannakermann‘ findet Anwendung, um die Identität und Traditionen dieser Gemeinschaft zu repräsentieren.
Von Abwertung zu Selbstbezeichnung
Der Begriff Kanake hat sich im Laufe der Zeit von einem Schimpfwort zu einer Form der Selbstbezeichnung entwickelt. Ursprünglich verwendet als abwertender Ausdruck für Menschen aus Südosteuropa, dem Nahen Osten, dem Mittleren Osten und Nordafrika, erlangte das Wort eine neue Bedeutung, als sich die Betroffenen, oft im Kontext von Migrationsbewegungen und kulturellen Begegnungen, selbstbewusst mit dem Begriff identifizierten. Pionierarbeit leisteten hier vor allem die sogenannten Kanaken, die sich den Ehrentitel in einem Akt der Reclaiming-Politik aneigneten. Dies geschah nicht zuletzt auch durch die modernisierte Wahrnehmung des Begriffs in populären kulturellen Referenzen, beispielsweise in den Medien und durch die Berichterstattung des Bertelsmann Verlags, die das Wort in ein moderneres Lexikon integrierten. Die Transformation von einem abwertenden Schimpfwort zu einem wertneutralen oder sogar positiven Identifikationsbegriff ist entscheidend für das Verständnis der Bedeutung Kanacke. Heutzutage ist die Bezeichnung für viele ein Zeichen der Solidarität und des kulturellen Stolzes, ähnlich wie die Identifikation von Seefahrer mit dem Titel Kanake, der in den entlegenen Regionen wie Hawaii und unter den Südseebewohnern eine eigene, stolze Tradition hat.
Varianten des Begriffs: Kanak-Sprak und mehr
Verschiedene Varianten des Begriffs Kanake sind in der deutschen Sprache und darüber hinaus zu finden, wodurch sich ein komplexes Bild ergibt. Kanacke, ein oft abwertend verwendeter Begriff, kann in bestimmten Zusammenhängen auch als Geusenwort fungieren, das von den Betroffenen selbst positiv besetzt wird. In vielen Regionen, darunter Südosteuropa, der Nahe Osten, Nordafrika sowie Ozeanien, wird das Wort oft zur Bezeichnung von Menschen mit südländischem Aussehen verwendet, was mit einer Vielzahl von Klischees und Diskriminierung einhergeht. Während in Deutschland die Bezeichnung Kanake häufig als Schimpfwort genutzt wird, finden sich bei den Ureinwohnern der Südseeinseln und der Polynesien ähnliche, aber kulturell kontextualisierte Begriffe wie Kannaker. Diese Divergenz zeigt, dass der Begriff nicht nur in der deutschen Sprache eine Rolle spielt, sondern auch in globalen Diskursen über Ausländerfeindlichkeit und die Geschichte der Kolonisation. So ist die Bedeutung Kanacke in verschiedenen Kontexten vielschichtig und spiegelt sowohl historisch gewachsene als auch gegenwärtige soziale Spannungen wider.
Gesellschaftliche Wahrnehmung und Verwendung
Die gesellschaftliche Wahrnehmung des Begriffs ‚Kanacke‘ ist stark von seiner historischen Verwendung geprägt. Ursprünglich im kolonialen Zeitalter als abwertendes Wort für Menschen aus Südosteuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika entstanden, entwickelte sich der Begriff zu einem Schimpfwort, das mit Diskriminierung und einem kolonial-rassistischen Neologismus verbunden ist. Geusenwort und Mythos von Kannibalen wurden im Kontext der Kolonialexpansion zur Identitätskonstruktion genutzt. Seefahrer brachten diese Begriffe aus ihren Reisen mit, wodurch eine Verbindung zwischen den historischen Eskapaden der europäischen Kolonialisierung und der heutigen öffentlichen Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund entstand. Besonders in Bezug auf die ethnischen Gruppen wie Kosaken, Hannaken und Polacken wird die gesellschaftliche Diskriminierung sichtbar. Die Bewegung Kanak Attak kämpft gegen diese tief verwurzelten Vorurteile und strebt nach Anerkennung und Rechte für die betroffenen Gemeinschaften. Diese gewachsene Identität der Kanake spiegelt sich in der aktuellen Debatte über Anti-Slawismus und die gesellschaftlichen Herausforderungen wider, die noch immer bestehen.